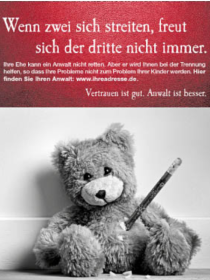Hilfe, mein Kind wird im Familiengericht angehört!
Die persönliche Anhörung des Kindes in Umgangs- und Sorgerechtsverfahren ist im Bezirk des OLG Köln ab Kindergartenalter die Regel. Manche Richter machen einen ersten Anhörungstermin noch ohne Kind, um zunächst eine Einigung der Eltern zu versuchen. Scheitert dies, muss das Kind geladen werden, wenn es über 14 ist oder der persönliche Eindruck vom Kind dem Gericht bei der Entscheidungsfindung helfen kann.
Gesetzliche Grundlage ist § 159 FamFG:
(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. Betrifft das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes, kann von einer persönlichen Anhörung abgesehen werden, wenn eine solche nach der Art der Angelegenheit nicht angezeigt ist.
(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhören, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind oder wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen angezeigt ist.
(3) Von einer persönlichen Anhörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 darf das Gericht aus schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt eine Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen.
(4) Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Verfahrens in einer geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert werden, soweit nicht Nachteile für seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu befürchten sind. Ihm ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Hat das Gericht dem Kind nach § 158 einen Verfahrensbeistand bestellt, soll die persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht die Gestaltung der persönlichen Anhörung im Ermessen des Gerichts.
"Ermessen des Gerichts" bedeutet also, dass jeder Richter die Anhörung so gestaltet, wie er es für richtig hält und wie er es kann.
Einen Aufsatz von Richter am Amtsgericht Dr. Thomas Köster, wie aus richterlicher Sicht die Ermittlung des Kindeswillens zu gestalten ist, finden Sie hier.
BGH XII ZB 419/15, Beschluss vom 15.6.2016:
Auch das betroffene Kind muss angehört werden. Entgegen einer in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Auffassung kann auf die Anhörung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, grundsätzlich nicht verzichtet werden.
Kann das Kind mit 14 selbst entscheiden?
Nein. Mit 18 ist man volljährig und entscheidet selbst, das ist auch im Familienrecht nicht anders. Dennoch hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Warum? Weil die Altersgrenze 14 ausdrücklich im Gesetz vorkommt, s.o..Selbst beim Jugendamt wird diese falsche Behauptung oft genug verkauft!
In der Praxis werden aber eben auch viel jüngere Kinder am Verfahren beteiligt oder gehört. Das, was sie zu sagen haben, wird je nach ihrem persönlichen Reifegrad berücksichtigt - nicht nach der festen Altersgrenze. Daher kann es auch vorkommen, dass ein Richter gegen den geäußerten Willen eines über-14-Jährigen entscheidet. Oder sich nach dem richtet, was ein 10-Jähriger sagt.
In einem Fall des Kammergerichts Berlin (13 UF 189/09) ging es um einen 16-Jährigen, der zwar seinen Vater sehen wollte, aber sich nicht ein ein alle-zwei-Wochen-Umgangsschema pressen lassen wollte. Er wollte selbst über Ort und Zeit eines Umgangs (mit-)bestimmen. Das KG befand, dass dies zu berücksichtigen ist - und eben nicht der Umgang mit dem Vater gerichtlich zu bestimmen ist. Dies käme dem Absprechen der freien Willensbildung bei dem 16-Jährigen gleich.
Anders herum: In einem Brandenburger Fall entschied das Gericht gegen den erklärten Willen eines Fast-15-Jährigen.
Der Fall:
Der 14jährige G. spricht sich in seiner Anhörung gegen vom Vater gewünschte feste Besuchskontakte mit Übernachtungen aus. Die Mutter meint, G. wünsche keine festen Umgangstermine. Er sei durch die
„Brechung seines Willens" psychisch stark belastet, seine positive Entwicklung werde gestört, sein Leistungsvermögen eingeschränkt. Er lehne es insbesondere ab, beim Vater zu übernachten.
Trotzdem ordnet das AG das vom Vater gewünschte Besuchsrecht an.
Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens hat das OLG die Entscheidung des Familiengerichts, den Umgang wie beantragt anzuordnen, bestätigt.
Aus den Gründen:
Der Umgang an den Wochenenden ist auch mit einer Übernachtung von Samstag zu Sonntag anzuordnen. Ein Kind in Gs Alter ist ohne weiteres in der Lage, zwei Nächte im Monat außerhalb des mütterlichen
Haushalts zu verbringen. Auch die Mutter hat bei ihrer Anhörung durch den Senat keine sachlichen Gründe genannt, die dagegen sprächen, sie hat nach eigenen Angaben auch keine Angst (mehr), wenn G.
beim Vater ist. Sonstige Gründe, die der Anordnung einer Übernachtung entgegenstehen, liegen nicht vor.
Der von G. insoweit geäußerten Ablehnung kommt kein entscheidungserhebliches Gewicht zu. G. hat sich zwar wiederholt, auch gegenüber der Verfahrenspflegerin, dahin geäußert, nicht beim Vater
übernachten zu wollen. Diese Äußerungen nimmt der Senat ernst, er würdigt sie aber auch vor dem Hintergrund, dass sich in ihnen, wie der Sachverständige im Senatstermin unter Bezugnahme auf sein
schriftliches Gutachten erläutert hat, die mütterliche Haltung ausdrückt. G. ist nach Ansicht des Sachverständigen so befangen, dass er den Gedanken, von sich aus zum Vater zu gehen, nicht zulassen
kann. Bei der Mutter schwinge, so der Sachverständige, stets eine Abwehr mit, selbst wenn sie ihrem Sohn sage, er dürfe zum Vater gehen.
Die Äußerungen von G. geben also keinen autonomen Willen wieder und beruhen im Übrigen nicht auf subjektiv verständlichen Beweggründen. Diese Einschätzung belegen auch die Briefe, die der jetzt fast
15 Jahre alte G. dem Senat geschrieben hat. Sie tragen erkennbar, wie auch der Sachverständigen ausgeführt hat, die Handschrift der Mutter, die selbst bei ihrer Anhörung durch den Senat eingeräumt
hat, G. zum Schreiben der Briefe angeregt zu haben. Nur G. selbst hat dem Senat gegenüber behauptet, die Briefe von sich aus verfasst zu haben. Dies zeigt, wie sehr G. von seiner Mutter abhängig ist
und seine Äußerungen im Wesentlichen auf ihren Vorgaben beruhen. Angesichts dessen kann die Entscheidung nicht auf den geäußerten Willen von G. gestützt werden. Es liegt vielmehr in seinem
wohlverstandenen Interesse, dass er seinen Vater regelmäßig besucht und dort auch übernachtet. Denn dadurch erhalten Vater und Sohn die Möglichkeit, nicht nur einige Stunden ohne Einflussnahme
Dritter miteinander umzugehen, sondern es wird auch mehr Raum für eine Wochenendgestaltung, die sowohl die Erledigung der Hausaufgaben als auch gemeinsame Unternehmungen ermöglicht, geschaffen.
Möglicherweise kann sich G. dann auch dazu entschließen, die Gutscheine des Vaters zum Besuch von abendlichen Veranstaltungen einzulösen und gewinnt Abstand von der einem Jungen in seinem Alter nicht
entsprechenden Einstellung, dass Abende nur dann gemütlich seien, wenn man sie vor dem Fernseher verbringe.
OLG Brandenburg - 20.05.10 - 10 UF 56/09
Was fragt der Richter mein Kind?
Das hängt vom Alter des Kindes, vom Streitstoff und vom Richter ab. Je jünger das Kind ist, desto mehr geht es "bloß" um einen persönlichen Eindruck vom Kind und die Frage nach seinem Alltag, seinen allgemeinen Neigungen und Bindungen zu den Eltern. Dem eigentlichen Thema wird ein Richter sich nur so nähern, dass dem Kind nicht suggeriert wird, ihm werde jetzt die Verantwortung für die Entscheidung des Streites der Eltern aufgebürdet. Ältere Kinder werden konkreter nach ihren Wünschen betreffend Umgang und elterliche Sorge gefragt. Die Befragung dauert vielleicht 10 Minuten, aber auch viel länger, wenn das Kind viel zu sagen hat.
Kann ich mein Kind auf die Anhörung vorbereiten?
Ja, wenn Sie unter "vorbereiten" bitte nicht verstehen, dem Kind vorzugeben, was es sagen solle. Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Anhörung eine große Belastung für ihn Kind sein wird, sagen Sie Ihrem Kind erst wenige Tage vor dem Termin, dass dieser stattfindet. Stellen Sie die Befragung als normal dar. Machen Sie Ihrem Kind klar, daß es nichts im Streit der Eltern zu entscheiden hat, sondern nur Gelegenheit bekommt, seine Meinung sagen zu dürfen. Sie können erklären, dass es das gute Recht eines Kindes ist, dass der Richter nicht wie über eine Sache, einen Gegenstand entscheidet, ohne das Kind je kennengelernt zu haben. Manchmal ist es für ein Kind, das dem Termin mit Anspannung entgegensieht, hilfreich, vorher das Gerichtsgebäude besuchen zu können. Dagegen bestehen keine Einwände. Für viele Kinder ist die Anhörung nicht so furchtbar wie die Eltern befürchten, manche fühlen sich gar entlastet, ihren Ballast an Verantwortung für die elterlichen Konflikte an eine professionellen Konflikt-Beender abgeben zu dürfen. Studieren Sie keinesfalls mit dem Kind bestimmte Aussagen ein; wenn das auffällt, wirft dies ein schlechtes Licht auf Ihr Anliegen.
Was kann ich noch beachten?
Wenn Ihr Kind schon Schulkind ist, kann es ihm peinlich sein, Vormittags ins der Schule zu fehlen und dafür eine Erklärung haben zu müssen. Bitten Sie dann um einen Termin nach Schulschluss. Wenn die Kindesanhörung gleichzeitig mit dem Verhandlungstermin der Eltern stattfindet, wird die mißliche Situation entstehen, dass beide Eltern im Gerichtssaal sind und das Kind allein auf dem Flur. Für jüngere Kinder wäre eine (neutrale) Begleitperson wichtig, für Ältere etwas zum Lesen oder Ablenken.
Entscheidet das Kind in der Anhörung über das Ergebnis des Verfahrens?
Nein. Zum Entscheiden ist der Richter da. Aber: Der vom Kind geäußerte Wille hat natürlich Gewicht für die Entscheidung
des Richters. Wie viel Gewicht - das kommt drauf an.
Kindeswohl und Kindeswille sind nicht Gegenbegriffe – der Kindeswille ist vielmehr ein Baustein der Defintion des Kindeswohles und hat daher auch seinen Platz im Gesetz: § 159 Abs. 2 FamFG, s.o..
Will das Kind etwas deutlich nicht (z.B. betreffend Kontakt zu einem Elternteil, einen bestimmten Lebensmittelpunkt etc.), so wird in der Regel geprüft:
- handelt es sich um einen autonomen stabilen Willen?
- wurde die Willensbildung von außen beeinflusst, gesteuert, induziert (offen oder verdeckt, bis hin zum Parental Alienation Syndrom PAS)?
Auch wenn es sich um einen autonomen Willen handelt, kann es dennoch vertretbar sein, gegen den geäußerten Willen des Kindes zu entscheiden. Eltern tun dies alltäglich, wenn sie Fernsehkonsum regulieren oder den Schulbesuch als zwingend erklären. Zur Entwicklung gehört es, eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln und zu erleben, dass die Erwachsenen nicht jeden vom Kind geäußerten Wunsch und nicht jeden mit Nachdruck vorgebrachten Willen berücksichtigen wollen oder können. Das objektive Kindeswohl setzt da Grenzen.
Umgekehrt gilt aber: Auch wenn es sich nachweislich um einen Willen handelt, den das Kind durch negative Beeinflussung gebildet hat, kann es vertretbar sein, den Willen zu berücksichtigen. Denn wenn das Kind inzwischen den fremden Willen zu seinem eigenen gemacht hat und davon keine innere Distanz aufbauen kann, kann das Kind selbst sich erheblich übergangen fühlen, wenn der Richter ausdrücklich gegen die eigenen Äußerungen entscheidet.
Wer nämlich über einen geäußerten Willen hinweggeht, muss sich über die Folgen Gedanken machen:
Wie würde der Zwang faktisch umgesetzt? Würde das Kind sich körperlich wehren? Würde das Kind somatisieren, d.h. aus psychischem Druck körperlich erkranken? Würde der Zwang das Kind traumatisieren? Oder, die Alternative: Würde das Kind in der erzwungenen Situation einsehen, dass dies zu seinem eigenen Wohl geschah?
Eine Langzeitstudie von Wallerstein & Lewis aus dem Jahr 2001 ergab, dass erzwungene Kontakte meist die Beziehungen des Kindes mit dem den Umgang begehrenden Elternteil nicht verbessern oder stabilisieren.
Die Frage, ob eine richterliche Entscheidung gegen die eindeutige Willensäußerung eines Kindes ausfallen kann, muss im Zweifel mithilfe von Verfahrensbeistand und Gutachter geklärt werden. Handelt es sich um ein sogenanntes lösungsorientiertes Gutachten, im Rahmen dessen mit den Beteiligten selbst an den bestehenden Schwierigkeiten gearbeitet wird, können sich Widerstände auch auflösen lassen.
Welche Informationen könnten jetzt noch passen?
Noch mehr wissen? Persönliche Beratung?
Informieren Sie sich über unser Erstberatungs-Konzept und die Online-Beratung zum Pauschalpreis. Rufen Sie uns an: 0241 5152657, schreiben Sie: info(at)kanzlei-mainz.de - oder nutzen Sie das Kontaktformular.